Onkomoderne
Singularitäten
2016:April //
Die Besucher würden sich zwei bis drei Videos in der Ausstellung auf den eigenen Phones ansehen, vielleicht zuhause noch ein paar mehr, zusammen mit anderen kurzen Clips und Newsschnipseln auf Youtube, Facebook usw., die um ihre Aufmerksamkeit konkurrierten. Das Auflösen des White-Cube-Ausstellungsformats hatte die mit hohem Engagement und Zeitaufwand entwickelten Arbeiten in einem verschachtelten Labyrinth aus voreinander geschalteten Schnittstellen fast verschwinden lassen. Mit dem konzeptuellen Dreh hatten die Studierenden ihre individuellen Arbeiten ganz bewusst dem digitalen Orkus anheimgegeben. Zwei Monate später bei den Bremer Hochschultagen zeigte die Klasse eine neue Version ihrer Installation: im Ausstellungssaal stellten sie Etagenbetten auf, die an ein Krankenhaus oder eine Flüchtlingsunterkunft erinnerten, auf die sich die Besucher zum Betrachten der Handyvideos zurückziehen konnten.
Das Auflösen und Weiterentwickeln von Ausstellungsformaten war neben der Ausgefallenheit der eigenen Arbeit auch noch zur Maßgabe für Künstler/innen geworden. Niemand glaubte jedoch mehr an hypothetische Anforderungen, die zur Nachahmung des Verhaltens besonders eifriger Kollegen anstiften wollten. Sobald eine ästhetische Neuerung auftauchte, verbreitete sie sich, wurde wiederholt, verwandelte sich in eine Art Meme und verwandelte sich zurück in eine Konvention. Ebensogut konnte man die Konventionen beibehalten, sich verweigern, Monochrome malen, im Bett liegen bleiben, Yoga üben, es führte weder zu gesellschaftlicher Bewegung noch zu Verbesserungen oder Fortschritt. Erfolg bei irgendeiner Form von Tätigkeit brachte oft nichts außer nur noch mehr Arbeit. Die Innovations- und Leistungsmotorik auf der kulturellen Ebene kaschierte die Lähmung im gesellschaftlichen und politischen Leben. Als Reaktion darauf tauchten in der bildenden Kunst ästhetische Trends wie die am Nihilismus der Pop Art geschulte Postinternet Art auf. Künstler versuchten, das Hamsterrad der Kreativität zu beschleunigen, indem sie Zeichen- oder Pixelkombinationen generierten, die sich von wiedererkennbaren semantischen oder metaphorischen Funktionen loslösten.
Laut dem Soziologen Andreas Reckwitz hatte sich seit den sechziger Jahren das Kreativitätsdispositiv nach und nach zum gesellschaftlichen Leitbild entwickelt. In einem Vortrag am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung im Februar stellte er sein neueres, erweitertes Forschungkonzept zum ästhetischen Kapitalismus unter dem Titel „Die Gesellschaft der Singularitäten“ vor. Er beschrieb, wie sich gesellschaftliche Wünsche hin zum Besonderen, Einzigartigen, Außergewöhnlichen und zur Abweichung von der Norm bündelten, sei es beim Konsum, bei Reisen und Ereignissen, im Lebensstil, in Projekten, bei Identitätsbezeichnungen, beim „kuratierten“ Facebookprofil. Der von ihm eingesetzte Begriff der „Singularitäten“ erlaubte es, dieses Phänomen auf den unterschiedlichsten Ebenen einzugrenzen. Singuläre Ereignisse gestalten sich im Hinblick auf ein Publikum und ein Gesehenwerden – sie werden performt –, gleichzeitig verbinden sie sich mit einer positiven sinnlichen und affektiven Erregung. Das Singuläre wendet sich gegen Verallgemeinerungs- und Angleichungsbestrebungen, wie sie in der fordistischen Moderne vorangetrieben wurden: Effizienz, Rationalität, Sachlichkeit, Standardisierung, Routine, Normativität und Affektarmut. In den letzten Jahrzehnten wurde das vertraute Modell einer routinisierten Arbeiter- und Angestelltentätigkeit zurückgelassen und die Gegenkulturen, die sich ihm verweigert hatten, waren in die Hegemonie umgekippt. Das zeitgenössische Subjekt, welches laut Reckwitz das Neue gegenüber dem Alten, das Abweichende gegenüber dem Standard, das Andere gegenüber dem Gleichen bevorzugt, bezieht aus der Arbeit an der Besonderheit das Gefühl einer Souveränität, die es nicht nötig hat, sich an die überkommenen Regeln zu halten. Dieser kulturelle Paradigmenwechsel bringt viele neue Probleme mit sich, die Reckwitz in einem Vortrag auf Vimeo, „Die Analyse des Kreativitätsdispositivs“, genauer beschrieb: Sobald Kreativität gesellschaftlich eingefordert wird, gehen damit Leistungszwang und dauerhafte Konkurrenz einher. Bei einer Überproduktion von kulturellen Gütern kann davon nur ein kleiner Teil vom Publikum wahrgenommen werden, vieles bleibt unsichtbar. Wer regelmäßig ästhetische Leistungen konsumiert und darin Genuss und Befriedigung findet, verliert bei Reizüberflutung seine Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit. Es entsteht ein Gefühl, das Reckwitz eine widersprüchliche Unbefriedigtheit nennt: man leidet darunter, dass es gleichzeitig zuviel und zuwenig Neues gibt, dass im Meer des vermeintlich Neuartigen nichts wirklich Neues mehr nachkommt. Wenn das Publikum als Zertifizierungsinstanz auftritt, verhält es sich widersprüchlich und unberechenbar. Herausragende kreative Leistungen werden nicht immer erkannt und mit Wert bemessen, oft führen sie nicht zum Erfolg. Wenn Kreativität gesellschaftliche Anerkennung ermöglicht, kann ein Nachlassen der Fähigkeit die soziale Herabstufung oder den Ausschluss mit sich bringen. Und letzendlich hat es das Kreativitätsdispositiv bisher nicht geschafft, tatsächlich neue Gesellschaftsmodelle zu entwickeln und durchzusetzen.
Der Konflikt zwischen einem Streben nach Singularität und der Verallgemeinerungen älterer Gesellschaftsformen, den Reckwitz herausarbeitete, kann hilfreich sein, um aktuelle Widerstände und reaktionäre Bewegungen zu beleuchten. Teile der Bevölkerung schlossen sich zusammen, um zurück zu vereinfachenden, konventionellen, die Gesellschaft klar eingrenzenden Modellen zu kehren. Je schneller sich das Neue und Innovative in Allgemeines zurückverwandelte, desto mehr entstand der beunruhigende Eindruck, dass die Beharrungs- und Absicherungskräfte des Verallgemeinernden an Boden gewännen.
Eine Freundin, die im Social-Media-Marketing arbeitet, erzählte mir von einem ihrer Projekte. Ein Reiseveranstalter hatte einen Fotowettbewerb für Instagram-Fotografen ausgeschrieben, als Preis war ein bezahlter Job zu gewinnen. Fünf Sieger würden auf Reise gehen und die firmeneigenen Hotels mit den angegliederten Landschaften gegen ein geringes Entgelt fotografieren – es handelte sich um Fotoaufträge, die unter den Bedingungen einer gerechteren Welt an höher bezahlte Profifotografen gegangen wären. Um sich zu bewerben genügte es, drei Fotos auf Instagram mit einem Hashtag des Firmennamens zu markieren. Etwa 1,8 Millionen Fotos wurden getaggt. Die Instagram-Seite mit bunten Ansichten einer heilen Welt, sonnenbeleuchteten Landschaften, lächelnden Gesichtern, geometrischen Pflanzen- und Architekturmustern, reichhaltigem Essen, exotischen Arbeitern unter Palmen und Frauen in bunten Saris ließ sich endlos herunterscrollen. Es erschien unmöglich, daraus fünf begabte Fotograf/innen herauszufischen. Mein Freundin erzählte mir, dass ihr Team, um sich zu orientieren, ein paar spontane Bildkategorien erstellt hatte: Menschen, die auf einen Abgrund blicken (zum Beispiel auf einen norwegischen Fjord), Menschen in 50 Meter Entfernung vor einer Landschaft, Cappuccino von oben, Selfies in Badebekleidung, HDR-Effekt, Menschen vor Sehenswürdigkeiten, Gesichter mit starken Emotionen. Es fiel ihr auf, dass das häufigste Bildklischee ein Caspar-David-Friedrich-Meme war, die Rückenansicht einer Person, die auf eine leere, bläulich-magenta beleuchtete Landschaft blickt – und sich, wenn man diesen Gedanken auf die uferlose digitale Bildproduktion bezieht, als den zentralen Punkt setzt, von dem der in perspektivische Linien aufgefächerte Blick ausgeht. Es handelt sich um ein konventionelles, romantisches Menschen- und Weltbild, welches die Masse der User durch ihre ästhetische Praktik zum Ausdruck bringt. Das Projektteam programmierte Algorithmen, die die Selektion vereinfachen sollten. Nach der Anzahl von veröffentlichten Fotos, Likes und Followern wurde eine berechenbares Ranking unter den Instagrammern erstellt. Anschließend sollte der Algorithmus eine „choose list“ von 8 Bildern vorschlagen, aus denen ein Jurymitglied ein oder zwei auswählte, die auf dem Bildschirm stehen blieben. Alle anderen wurden durch neue ersetzt. Das Programm sollte lernen, den Stil oder Geschmack des auswählenden Menschen zu imitieren und im Laufe des Prozesses eine Ähnlichkeit in den Selektionskriterien herauszubilden. Affekte, Empfindungen, Ironie, Konnotationen, Bezüge zu anderen Welten und Ideen, metaphorische Eigenschaften und schließlich die Grenze, an der Bildklischees zu künstlerischer Singularität übergehen, ihre Bedeutung wandeln und ihre Richtung wechseln, alles das müsste der Algorithmus noch lernen zu erkennen. Die Vision einer lernenden, selbstdenkenden Superintelligenz, die die mentalen Fähigkeiten der Menschheit bündelt und um vielfaches überschreitet, wie sie kalifornische Zukunftsforscher und Computerwissenschaftler seit den achtziger Jahren unter dem Begriff „Singularität“ beschrieben, war das Gegenteil der Flucht ins besonders Individuelle. Sie würde alle Einzigartigkeiten tracken und zusammenführen, Zugriff darauf gewinnen und ganz andere, die Menschen weit übertrumpfende Spitzenleistungen generieren. Die Vorstellung einer totalvernetzten, gottähnlichen Superstruktur war ein Alptraum für die meisten historisch bewussten und vernunftbegabten Menschen. Soweit waren die Rechenmaschinen zum Glück noch nicht gekommen. Die Auswahl der fünf talentiertesten Instagram-Amateure aus 1,8 Millionen Bewerbern würde am Ende wie eine Lottoziehung zustande kommen. Doch die menschliche Subjektivität, die ganz andere Fähigkeiten und Beschränkungen als die Algorithmen aufwies – Boris Groys hatte mal gesagt, der wesentliche Unterschied war ihre Möglichkeit, einfach mit etwas aufhören zu können – würde sich letztendlich in ästhetischen Entscheidungen auch nicht anders als eine Lottotrommel verhalten.

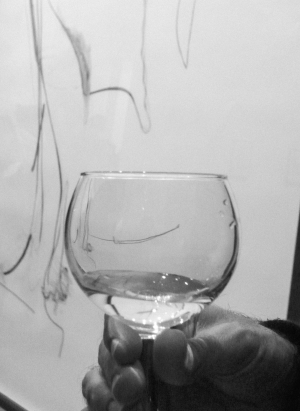


Alle Fotos: Christina Zück