So weit die Füße tragen
Einkommen, Wohnen und Pflege als zentrale Themen des Alters
2014:Dez //
Optimismus als Programm
Auch wenn die Unzufriedenheit über Wohnungsknappheit, zunehmende Armut und Mängel in der Infrastruktur nicht nur im öffentlichen Diskurs wächst, die Zuversicht der Mehrheit der hier Lebenden können diese Trends offenbar nicht trüben. Im Gegenteil: Knapp 70 Prozent der Hauptstädter rechnen damit, dass sich die Stadt in den nächsten fünf Jahren positiv entwickeln wird. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Hertie-Stiftung, die Anfang November unter dem Titel „Hertie Berlin Studie“ veröffentlicht wurde. Das Papier ordnet die Städter in einzelne „Milieus“ unter. Demnach zählt sich fast jeder Fünfte (18 Prozent) zu den „Hedonisten“, die sich in den letzten Jahren vor allem im Aufsteiger-Bezirk „Kreuzkölln“ angesiedelt haben. Die „Konservativ-Etablierten“ leben – materiell abgesichert – in Frohnau und Zehlendorf. Die „bürgerliche Mitte“ findet man am ehesten in Treptow-Köpenick, die „Liberal-Intellektuellen“ sind in Steglitz-Zehlendorf beheimatet. Während die leistungsorientierten „Performer“ in der „City-West“ anzutreffen sind, orten die Wissenschaftler das Milieu der „Adaptiv-Pragmatischen“ im Ost-Bezirk Pankow, wo die mit Abstand meisten erwerbstätigen Frauen mit Kindern leben. „Der Optimismus ihrer Bewohner gepaart mit der offensichtlich hohen Anziehungs- und Integrationskraft der Stadt ist ihr derzeit größtes Potenzial“, resümiert Helmut K. Anheier, einer der Ersteller der Studie.
„Kreative“ und „Prekäre“ in der „Hartz IV-Hauptstadt“
Blickt man allerdings hinter die Kulissen bestimmter „Milieus“ eröffnet sich eine eher nüchterne Seite der allgemeinen Euphorie. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Arbeit leben in Berlin knapp 130.000 Menschen, die trotz Erwerbstätigkeit zusätzlich Sozialleistungen beziehen (Stand 2012). Zum Vergleich: Anfang 2007 waren es noch etwa 87.000. Die am stärksten betroffenen Gruppen sind regulär sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Gastgewerbe, in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie Minijobber und Selbstständige. Insbesondere in den neu entstandenen Berufsbildern der „kreativen Klasse“ bestimmen individuelle Überlebensstrategien den Alltag. Netzwerken und Nebenjobs, Selbstausbeutung und Selbstvermarktung, Kostenreduzierung und Konsumverzicht sind ständige Begleiter. So auch bei der „Start-up-Szene“, die weitestgehend ohne politische Steuerung entstanden ist. Lediglich eine von zehn Gründungen kann sich laut Arbeitsverwaltung überhaupt am Markt halten. Von der Politik gern als „Job-Maschine“ gefeiert, existieren in Berlin gerade 2500 Start-ups mit geschätzten 20.000 Mitarbeitern. Das sind keine 2% der aktuell 1,2 Millionen in Berlin Beschäftigten. Und von den 247.000 Solo-Selbstständigen in Berlin befindet sich der überwiegende Teil in prekären Lebens- und Einkommensverhältnissen, die sich häufig nur mit (branchenfremden) Praktika, Zeitverträgen und Dumpinglöhnen über Wasser halten können.
Ein ähnliches Bild bietet sich in der Künstler-Szene, die sich infolge der von der Finanzkrise ausgelösten immobilienwirtschaftlichen Inwertsetzung sowohl im Gewerbe- als auch im Mietwohnungssektor angesichts eines mit 850 Euro bezifferten durchschnittlichen Einkommens pro Monat enormen Existenzängsten ausgesetzt sieht. „Bis zu 77 Prozent der Künstlerinnen und Künstler haben keine ausreichenden Mittel für sich und ihre professionelle Arbeit, Wohnmiete und die Anmietung eines Ateliers“, heißt es in einem Rundbrief des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlin e.V.
Selbst wenn sich im Spannungsfeld von beruflicher Freiheit und materieller Unsicherheit neue Lebensstile artikulieren und biografische Brüche vergegenwärtigen, mit den Fragen des Alterns und Alters präsentieren sich allen Marktteilnehmern und Milieus schon heute gewaltige Probleme der Zukunft. Der Wandel der Arbeitsgesellschaft und die schrittweise Privatisierung der sozialen Sicherungssysteme gehen einher mit den Folgewirkungen der weiter steigenden Lebenserwartung, einer sinkenden Geburtenrate, der „Versingleung“ in den Großstädten und dem Wegbrechen traditioneller Haushalts- und Familienstrukturen. Dies trifft sowohl die bis dato „klassischen“ Armutsrisikogruppen aus den „bildungsfernen“ Schichten und dem industriellen Beschäftigungssektor als auch die Träger der neu entstandenen Berufsbilder im Dienstleistungsbereich und den „bildungsnahen“ Akademikerkreisen.
Armutsrisiken im Alter
Der Beschäftigungsboom der vergangenen Jahre hat zwar statistisch zu mehr Erwerbstätigkeit geführt, die Gefahr der sozialen Deklassierung und der Altersarmut jedoch nicht reduziert. Im Gegenteil. Hintergrund des gestiegenen Armutsrisikos ist neben der „Rentenreform“ aus dem Jahr 2003, wonach das Rentenniveau bis 2030 von derzeit 51 Prozent auf 43 Prozent des durchschnittlichen Nettolohns vor Steuern sinkt, insbesondere der sich ausweitende Niedriglohnsektor. Nach Berechnungen des Bundesministeriums für Arbeit erhielte ein Arbeitnehmer mit einem Bruttolohn von 2500 Euro nach 35 Erwerbsjahren eine Monatsrente von lediglich 688 Euro. Berlin nimmt derzeit bundesweit den Spitzenplatz ein. Während in Deutschland 36 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten weniger als 2500 Euro monatlich verdienen, sind es in der Hauptstadt fast 40 Prozent. Das aktuelle Renteneintrittsalter mit durchschnittlich 63 erweist sich hierbei zusätzlich als „Brandbeschleuniger“. Zudem: Fast ein Viertel aller 55- bis 64-Jährigen geht aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand und muss deshalb mit wesentlich umfangreicheren Rentenkürzungen rechnen.
Noch liegt das monatliche Pro-Kopf-Einkommen der Rentner in Berlin in der Altersgruppe der 65- bis 70-Jährigen im Schnitt bei 1100 Euro. Wie groß der Anteil der zukünftig „Altersarmen“ sein wird, verdeutlicht, dass im Jahre 2014 bereits jeder vierte erwerbstätige Stadtbewohner einen Niedriglohn bezogen hat. Der „Bericht zur sozialen Lage älterer Menschen“ der 2011 von der rot-roten Koalition an der Spree in Auftrag gegeben wurde, kündigt eine weitere unausweichliche Herausforderung an: die Zahl der „Alten“ wird rasant zunehmen. Demnach werden im Jahre 2030 mehr als 59.000 Berliner 90 Jahre oder älter sein. Das sind doppelt so viele wie derzeit. „Altersarmut“ verfestigt sich laut Untersuchung vor allem in den Ortsteilen Kreuzberg, Wedding und Neukölln. Innenstadtlagen, in denen bereits heute eine hohe Zahl der Bewohner mit Niedriglöhnen konfrontiert, auf Sozialleistungen angewiesen und erheblichen Mietsteigerungen ausgesetzt ist.
Dort werden zukünftig Rentner und Pensionäre leben, deren Einkünfte sich zwischen 600 Euro und 800 Euro pro Monat bewegen. Während die Autoren des Papiers in ihren Schlussfolgerungen für einen flächendeckenden Mindestlohn plädieren und die „Reichweite von Tarifverträgen“ erhöht sehen wollen, zeichnen sich entsprechende Entwicklungen vorerst nicht ab. Stattdessen folge in einer zunehmenden Zahl von „Fällen“ vielmehr kein direkter Wechsel vom Beruf in den Ruhestand. Arbeitslosigkeit und atypische Beschäftigungsverhältnisse prägten die letzte Phase des Erwerbslebens.
Kampf um Ressourcen und Raum
Sind Transferleistungsbezieher und einkommensschwache Haushalte schon heute den gesetzlich limitierten Zuwendungen für den Lebensunterhalt und die Unterkunftskosten ausgesetzt, dürfte sich auch innerhalb dieses wachsenden „Prekariats“ der Kampf um Ressourcen und Raum zuspitzen. Eine Schlüsselfunktion dürfte dabei alters- und bedarfsgerechten Wohnkonzepten zufallen. Laut einer Studie des Kuratoriums Deutsche Altershilfe wird im Zuge des demografischen Wandels bereits im Jahr 2020 bundesweit jeder vierte Haushalt zur Generation 65+ zählen. Demgegenüber gelten gerade einmal 1,4% der verfügbaren Wohnungen als barrierefrei oder barrierearm. Auch Berlin drohe eine „graue Wohnungsnot“. In den kommenden Jahren werde es in der Stadt eine extrem ansteigende Nachfrage bei altersgerechten Wohnungen geben. Das Pestel-Institut ermittelte in einer Studie mit dem Titel „Wohnsituation im Alter“, dass von den tatsächlich erforderlichen altersgerecht sanierten oder neu gebauten Wohnungen nur ein Bruchteil zur Verfügung stünde. Bis 2025 seien mehr als 87.500 seniorengerechte Wohnungen in der Hauptstadt nötig.
Erreicht werden müsse laut Pestel-Institut, dass im Interesse eines selbstbestimmten Lebens die Dauer des Verbleibs in der eigenen Wohnung so lange wie möglich gewährleistet werde. Dieses Ziel habe auch eine ökonomische Dimension, da die stationäre Pflege in Heimen erheblich teurer sei als die ambulante Pflege in den eigenen vier Wänden. „Langfristig könnten mit öffentlicher Förderung geschaffene Bestände an seniorengerechten Wohnungen erheblich zur Entschärfung des Problems der Altersarmut beitragen und gleichzeitig die öffentlichen Haushalte entlasten.“ Beziffere man die Kostendifferenz zwischen ambulanter Pflege zu Hause und stationärer Pflege im Heim mit rund 1500 Euro pro Monat, beliefen sich die gesamtwirtschaftlichen Einspareffekte bis zum Jahr 2025 auf 2,9 Milliarden Euro und bis zum Jahr 2035 auf 3,2 Milliarden Euro, so das Pestel-Institut.
Während laut Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Ende 2007 bereits 630.300 Menschen in der Hauptstadt lebten, die über 65 Jahre alt waren, prognostiziert die Behörde für 2030 rund 818.700 Menschen im Seniorenalter. Zum Vergleich: Eine zu altersgerechtem Wohnen 2011 durchgeführte Befragung von insgesamt dreizehn Wohnungsunternehmen, darunter die sechs landeseigenen, hatte ergeben, dass sich lediglich rund 8000 Wohnungen im Bestand der städtischen Wohnungsgesellschaften und noch einmal 4000 Wohneinheiten bei den Genossenschaften befanden, die den Mindeststandards altersgerechten Wohnens entsprachen. Der Bedarf ist also immens. Obwohl auch diese Entwicklung seit Jahren bekannt ist, hat der Berliner Senat erst jetzt auf die Herausforderung „Wohnen im Alter“ reagiert. Jedenfalls auf dem Papier. So heißt die Zielvorgabe in dem in diesem Jahr vorgelegten Stadtentwicklungsplan Wohnen (StEP) 2025: „Bedarfsgerechter Wohnungsneubau und Anpassung des Berliner Wohnungsbestands im Zuge der demographischen Entwicklung für ein kinder- und familienfreundliches Berlin und für ein möglichst langes und selbstständiges Wohnen im Quartier und den eigenen vier Wänden.“
Altersgerechtes Wohnen oder Senioren als Kapitalanlage
Doch angesichts der allgemeinen Einkommensentwicklung, der sinkenden gesetzlichen Rente und der Forderung nach privater Vorsorge, schreibt der Gesetzgeber im Rahmen des § 40 Absatz 4 des Sozialgesetzbuchs (SGB) XI zwar vor, dass die Pflegekasse verpflichtet ist, finanzielle Zuschüsse für „Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfelds“ zu gewähren, wenn „dadurch die häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert oder eine möglichst selbstständige Lebensführung des Pflegebedürftigen wiederhergestellt wird“. Allerdings müssen die Betroffenen nicht nur eine Eigenleistung in Höhe von 10% entrichten, sondern die Maßnahme, begrenzt auf 2557 Euro, bleibt weit unter den tatsächlich notwendigen Aufwendungen. Insofern ist die öffentliche Hand ohnehin in der Pflicht. Um den bereits existierenden Versorgungsnotstand abzubauen und das aufgrund der wesentlich kostenintensiveren Krankenhaus- und Heimaufenthalte drohende finanzielle Desaster für die öffentlichen Kassen abzuwenden, wäre neben der bedarfsgerechten Anpassung der Wohnungsbestände vor allem gezielter kommunaler Mietwohnungsbau nötig, der auch mietpreisdämpfend auf den gesamten Wohnungsmarkt wirken würde. Sonst heißt es in den Werbebroschüren der Immobilienfonds auch zukünftig: „Investieren Sie in ein Pflegeheim, 7,25% Rendite pro Jahr, Einnahmen staatlich garantiert.“
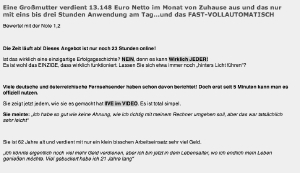
Spammail 2014