Croissant unterm Hakenkreuz
Kunstbetrieb und Rechtsruck
2024:Mai //
Kaum zwei Jahre später, in Zeiten von Ukraine- und Gaza-Krieg, dem Return of the Walking Trump, ist es schon nicht mehr ganz so performativ, unser kleines Croissant-Erwachen. Meloni gilt als stärkste Regierungschefin in Europa. Sie und van der Leyen sind ein Team und tun alles, um Migrantinnen von Europa fernzuhalten, den Green Deal der EU zu verwässern. Meloni ist das post-faschistische Postergirl. Die extreme Rechte ist flirty, mehr Sex-in-the City geworden. Nicht nur, dass sie erstaunlich divers ist, dass Frauen mit migrantischem Hintergrund, Gays und Lesben ganz vorne stehen, wenn es darum geht eine rassistische, inhumane Migrationspolitik vorantreiben. Es ist egal, dass die Rechte die Regenbogenponys zum Schlachter bringen will. Vor kurzem hat die schwule Plattform „Romeo.com“ 10.000 Homos befragt, wen sie morgen wählen würden. 22,3 Prozent entschieden sich für die AfD. Es ist ganz normal, dass Leute mit Barber-Frisur, Banksy-Poster in der Küche und Kindern in der Waldorfschule reden wie Alt-Nazis. Ja, super die Bezahlkarte, aber eigentlich sollte man „die“ in den Steinbruch oder zum Spargelstechen schicken, Leberkäse ja, Alkohol nein. Oh ja, auch 22 Prozent der 14- bis 29-Jährigen würden AfD wählen, wenn heute Bundestagswahl wäre. Es ist gesellschaftsfähig, dass weiße, satte Menschen ungeniert von anderen Menschen wie Biomüll reden, seien die nun Geflüchtete, Kinder in Gaza, Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Das Völkische ist zurück, aber im Bridgerton-Gewand: du kannst auch braun, schwarz oder behindert sein, wenn du zur herrschenden Klasse gehörst. Hauptsache, du bist nicht woke oder antisemitisch – wie die linken jüdischen Frauen und non-binary Menschen, die in Deutschland schneller gecancelt werden, als Mary Poppins in die Finger schnippt. Alle Göttinnen in meinem linken Lebenshilfe-Bücherregal sind als self-hating Jews und Antisemitinnen auf der Shitlist, von Judith Butler, Masha Gessen, Nancy Fraser bis zu Naomi Klein. Und mein Teen-Idol Laurie Anderson darf ihre Folkwang-Professur auch nicht antreten, weil sie etwas Pro-Palästinensisches unterschrieben hat. Oh Superman! Anstatt die Hallen zu vergrößern, um zu diskutieren, was antisemitisch ist, wie man in diesem Dilemma politisch handeln, denken, miteinander sprechen kann, wird dir erst mal der Saft abgedreht, du antisemitisches Croissant!
Womit wir beim Thema wären, dem Kunstbetrieb, der doch angeblich eine Art Kirche ist, in dieser krisengeschüttelten Zeit. Hier gibt es Asyl, für die Dauer einer Ausstellung oder der Amtszeit einer Kuratorin. Museen, Institutionen, private Initiativen, Projekträume, das sind Schutzräume, in denen noch „anders“, interdisziplinär, poetisch, performativ miteinander geredet werden kann. Ob es um Gaza, Klima oder Trans-Rechte geht, in der Kunstwelt wird das „anders“ verhandelt als in der Politik, auf der Straßen, „im wirklichen Leben“. Institutionen gehören nicht so ganz zu diesem Leben, sie begreifen die politische Rechte nicht als Teil der eigenen Infrastruktur, sondern als etwas, das draußen ist. Und das, obwohl Museen als öffentliche Räume deklariert werden, man sich „gesellschaftlich engagieren“, den „Dialog“ will und viele der Akteure des Kunstbetriebs ihre jeweilige Praxis als Aktivismus begreifen.
Dabei ist rechts schon lange drinnen. Es gibt rechte Hipster-Künstler*innen, die schlechte postkonzeptionelle Meme-Kunst machen und ihren Gebetsteppich in Richtung von Steve Bannons „War Room“ ausrollen. Ein Bekannter von mir, US-Amerikaner, mit dem ich seit zwei Dekaden in der Kunst arbeite, ist Robert-F.-Kennedy-Jr.-Fan, Impfgegner, Aids-Leugner und findet Tucker Carlson ok, er lädt doch so viele unterschiedliche Leute ein. Immer mehr Leute erscheinen wie ausgetauscht, auch in meinem Umfeld, werden reaktionär oder verschwinden in diesem „Rabbit Hole“, das Naomi Klein chirurgisch genau in ihrem Buch „Doppelgänger“ (2023) beschreibt – eine Art Spiegelwelt aus Verschwörungstheorien, Frustration und Angst. Und was fast alle verbindet, ist, dass sie nach eigenem Bekunden früher mal „links“ oder „feministisch“ waren, aber wegen der elitären „Wokeness“ davon abgekommen und aufgewacht sind. Und dieses Statement kommt nicht nur von alten Verschwörungs-Säck*innen, sondern genauso von Heerscharen von jungen Künstler*innen, auch mit Migrationshintergrund, die sämtlich in ihrer Arbeit Identität, Gender, Body Politics, das Erbe des Kolonialismus und Klasse verhandeln, irgendwie kritisch, biografisch, aber nicht offen politisch. Das ist völlig legitim. Ich finde auch, dass Kunst keine politischen Haltungen illustrieren muss, machen kann, was sie will. Aber der Trend, irgendwie im Diskurs zu sein, ohne die Dinge, auch in Gesprächen, beim Namen zu nennen, hat mehr mit der Angst zu tun, Käufer, Sammler, Institutionen zu vergraulen, oder einen Shitstorm auszulösen. Man will es allen rechtmachen.
Das Ergebnis sind jedoch am Ende weitgehend entpolitisierte Kunstmessen und Ausstellungen, die aus Kolonialismus- und Kapitalismuskritik, indigenem Wissen, spekulativen Erzählungen und marxistisch-feministischen Ideen eine Art Wellness-Bereich für die herrschenden Klassen bauen. Der Mainstream-Kunstbetrieb möchte das gütige, Insta-taugliche Gesicht des Kapitalismus sein und auf der richtigen Seite stehen. Du kannst dich als Milliardenerbin Slash Aktivistin in der Kunstwelt austoben, Walfischgesänge als Opern aufführen oder drei Plastiklatschen aus dem Meer fischen, während dein Unternehmen nichts an seiner Umweltbilanz ändert. Du kannst für Demokratie und Menschenrechte eintreten, während deine Firmen mit rechtsextremen Oligarchen oder Fundamentalisten zusammenarbeiten. Als Ausgleich lässt du dich dann auf Biennalen von indigenem Wissen heilen und horchst am Atem der ächzenden Mutter Erde. Alle wissen um diesen Widerspruch. Niemand, weder die „aktivistischen“ Philanthrop*innen, noch die Künstlerinnen, Kuratorinnen, Theoretikerinnen oder Autorenrinnen, die den Überbau zu ihrem Engagement liefern, glauben diese Story wirklich. Aber alle sagen, ja, Madame, was Sie da tun, ist echt empowernd, darf ich auf die nächste Exkursion mitkommen? Obwohl der Widerspruch, der Interessenkonflikt viel interessanter ist als die Walgesänge, hält man an dieser langweiligen Story fest. Warum?
Weil es eine Frage des Brandings ist. In „Doppelgänger“ spricht Naomi Klein über den Erfolg ihres ersten Bestsellers „No Logo“ (1999), der sich gegen die Macht und Gier von großen Markenfirmen richtete und millionenfach verkaufte. Und den Vorwurf von Kritikern, dass sie in ihrer Anti-Haltung und dem ausgefeilten Design des Covers selbst zu einer Art Marke geworden sei. Klein zitiert dazu den US-Autor Tom Peters. Der schrieb 1997, lange bevor es die Sozialen Medien gab, im Magazin „Fast Company“ einen legendären Artikel: „The Brand Called You“. Darin sprach er über die Idee des Personal Brandings – und wurde dafür als Extremist verspottet: „Unabhängig vom Alter, unabhängig von der Position, unabhängig von der Branche, in der wir tätig sind, muss jeder von uns begreifen, wie wichtig Branding ist. Wir sind die CEOs unserer eigenen Unternehmen: Me Inc. Um heute im Business zu bleiben, ist unser wichtigster Job, der Top- Vermarkter für unsere Brand zu sein, die „Du“ heißt.“
Wir sind alle kleine Corporations. Es geht um permanenten Wettbewerb, selbst mit den Kollegen in der Versandabteilung, Nachbarn, Followern. Klein schreibt, wie ihre vermeintliche Unschuld aus dem Fenster flog: „ Ich wurde mir klarer darüber, warum diese Idee eine Brand zu sein, so unangenehm für mich war. Gute Brands sind immun gegen grundsätzliche Veränderung.“ Deswegen holen sich Firmen auch „Marken-Botschafter“, wie etwa Nike zu den High Times von Black Lives Matter den Football-Spieler Colin Kaepernick, der sich im August 2016 aus Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt nicht zur US-Nationalhymne erhob. Oder die Biermarke Bud Light, die 2023 als Ausdruck ihrer liberalen Haltung die Transgender-Influencerin Dylan Mulvaney anheuerte – und angesichts eines Shitstorms der MAGA-Crowd blitzschnell wieder fallen ließen.
Genauso funktionieren heute Institutionen, aber auch die Akteure im Kunstbetrieb. Deutlich wurde das schon 2018, mit den Protesten von Nan Goldin gegen die korrupte Sackler-Familie, die ihr immenses Vermögen mit Oxycontin machte, einem Medikament, das Amerika in die Opioid-Krise stürzte. Natürlich wussten Museen wie der Louvre, das Guggenheim, die Londoner National Gallery schon vorher, dass die Sacklers Verbrecher sind, genauso, dass BP nicht gerade umweltfreundlich ist. Bis dahin störte sie das nicht. Was sie zur Kündigung der Sponsorschaft der Sacklers brachte, war nicht Einsicht, keine interne Diskussion, sondern der drohende Image-Schaden. Nur eine berühmte Künstlerin wie Goldin konnte das mit der Drohung, ihre Arbeiten abzuziehen, vollbringen – und selbst für sie war das riskant. Dieselben Museen, die nur unter solchem Druck nachgeben, wollen moralische Instanzen sein, ihren Kanon ändern, Kolonialismus, Faschismus und den Rest aufarbeiten.
Soll sich was in Institutionen oder Galerien ändern, muss allerdings erst mal Candice Breitz wie ein Habicht um den Hühnerstall kreisen, Imageschaden, krah, krah, bibber, bibber. Und dann rollt ein Kopf, ist ein Huhn weg, aber der Stall funktioniert genauso weiter, zu dem ja auch irgendwie der Habicht gehört.
Wir hängen mit drin, sind alle Hühner und Habichte. In diesem Hühnerstall ist alles performativ. Das ist eigentlich super, ich finde diese Forderung nach Authentizität oder Wahrhaftigkeit, gerade angesichts der politischen Lage eher heikel. Das Problem ist, dass sich die Performativität in der alles beherrschenden Branding-Kultur immer nur binär, wie im Kasperle-Theater gestalten kann, du Linke, du Rechte, du Gute, du Schlechte. Wie entmutigend und ätzend das sein kann, zeigte der „Skandal“ um „Where Your Ideas Become Civic Actions (100 Hours Reading „The Origins of Totalitarianism“)”, die 100-stündige Performance der kubanischen Künstlerin Tania Bruguera im Hamburger Bahnhof. Ursprünglich wurde die Performance 2015 in Brugueras Haus in Havanna aufgeführt, als die Künstlerin aufgrund politischen Drucks von der Teilnahme an der Biennale von Havanna ausgeschlossen wurde. Bruguera und 50 weitere Personen, die ihre Solidarität gegen Zensur und Repression bekundeten, lasen 100 Stunden durchgehend aus Arendts 195 Werk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ und diskutierten es mit dem Publikum. Die Lesung wurde aus Protest mit Lautsprechern auf die Straße übertragen Die kubanischen Behörden warfen als Antwort Presslufthämmer vor Brugueras Haus an.
Jetzt also eine Art Reenactment im Hamburger Bahnhof, auch als Reaktion und Kommentar zu den politisch aufgeheizten Debatten um Gaza, Genozid, Rassismus und Antisemitismus nach dem 7. Oktober. Bruguera, die auch jüdisch ist, hatte einen breit gefächerten Kreis von Lesenden eingeladen, zu der ebenso Candice Breitz wie auch Masha Gessen, wie auch Mirjam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, und auch von der Künstlerin eingeladene pro-palästinensische „Aktivisten“ gehörten. Die störten dann am 11. Februar einmal quasi in Absprache und ein zweites Mal, in einer anderen Zusammensetzung, viel aggressiver die Arendt-Lesung – mit den Chants, die auch bei Demos gesungen werden, Beschimpfungen, Statements, wie Deutschland sei ein faschistischer Staat. Es kam zu Tumulten, die Performance wurde abgebrochen.
Ich war nicht da. Aber Freunde, die da waren, erzählten, dass man in der hallenden Bahnhofshalle des Museums die Lesenden sowieso kaum verstehen konnte. Es sei also wohl weniger um Arendts Text gegangen, als um die Vortragenden. Zudem gehörten zu den Protestierenden auch Hipster aus Neukölln, Leute, die voll zum Kunst- und Kulturbetrieb gehören, Ex-Pats, die den Protest als anti-kolonialistisch verstehen. Das ist auch ok. Blöd ist nur, Bruguera und den anderen Teilnehmern vorzuwerfen, sie würden „nur“ performen, während ein Genozid begangen wird, und die eigene Performance außer acht zu lassen, so zu tun, als sei man wahrhaftiger, „echter“ als die privilegierten weißen Künstlerinnen. Das ist Bullshit. Auch bei den Gaza-Protesten auf der Biennale in Venedig, bei denen „Shame“ gerufen wurde, kam ein Aufschrei, wie man angesichts der Gewalt noch so eine Veranstaltung durchziehen kann. Und man sah dieselben Aktivistinnen eine halbe Stunde später entspannt durch die Pavillons schlendern. Das ist wieder ein interessanter Widerspruch, ich meine das nicht ironisch. Es gibt eine Verbindung, es ist tatsächlich eine Infrastruktur, in der demonstriert, Kunst angesehen und gemacht wird. Es ist das Dilemma, das uns verbindet. Es ist nur gefährlich, die eigene ambivalente Rolle in diesem Schlamassel zu verschleiern, weil das dem Image schadet, also auch die eigenen Privilegien und Ambitionen, in genau dem Hühnerstall zu arbeiten, gegen den man demonstriert. Dabei sind diese Proteste absolut wichtig, Teil einer funktionierenden Demokratie.
Doch die wird ausgehöhlt, wenn es weiter nur darum geht, auf der richtigen Seite zu stehen darum, lieber nicht die tatsächlichen, sehr komplexen Hierarchien und Machtverhältnisse zu benennen. Wir haben keine Zeit mehr. In „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ schreibt Hannah Arendt: „Totalitäre Politik ist keineswegs einfach antisemitisch oder rassistisch oder imperialistisch oder kommunistisch, sie gebraucht und mißbraucht vielmehr ihre eigenen ideologischen und politischen Elemente so lange, bis die reale Tatsachenbasis, aus der die Ideologien anfänglich ihre Stärke und ihren Propagandawert bezogen – die Realität des Klassenkampfes z. B. oder die Interessengegensätze zwischen den Juden und ihren Nachbarn –, so gut wie verschwunden ist.“
Genau das wollen die Neo-Faschisten und die AfD. Wenn sie demnächst an die Macht kommen sollten, müssen sie im Kunstbetrieb gar nicht mehr so viel tun, weil der das in seiner selbstgerechten Performativität und kapitalistischen Folklore schon selbst besorgt hat. Dabei wäre es so toll, gemeinsam in der Suppe zu schmoren, unsere eigenen Widersprüche als wirkliche Chance, als Verbindung zueinander zu begreifen. „Gänzliche Illusionslosigkeit über das Zeitalter und dennoch ein rückhaltloses Bekenntnis zu ihm.“ Das hat einmal Walter Benjamin gefordert. Auch das ist ein Widerspruch, aber einer, der Hoffnung macht.
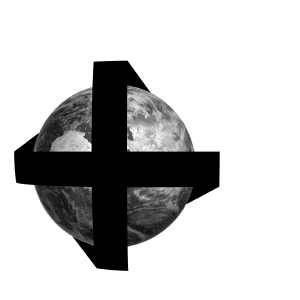

Illustrationen Andreas Koch, ursprünglich für die Ausstellung „Global National – Kunst zum
Rechtspopulismus“ kuratiert von Raimar Stange, 2019, Haus am Lützowplatz