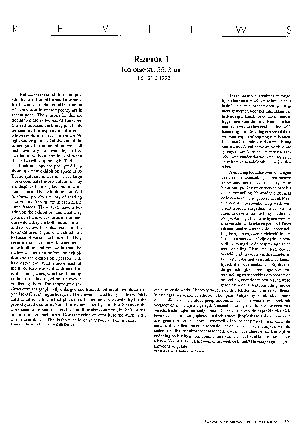Der Titel ist unvollendet. Handelt es sich dabei um eine Leerstelle, die bewusst offen gelassen wird? Oder steht das offene Ende für eine endlose Repetition, die auf sich selbst verweist? Dem selbstrefentiellen Modus widerspricht der Begriff der Konstruktion, bei dem am Ende ein Objekt steht. Dieses Objekt aber wird gleichzeitig als eine Rekonstruktion begriffen, wobei nicht eindeutig geklärt ist, welcher Prozess an erster Stelle steht. Ist die Konstruktion gleich zu setzen mit der Rekonstruktion? Wir sind geneigt, das zu verneinen. Denn die Rekonstruktion bezieht sich schon auf einen Plan, ein Objekt, einen Gegenstand, der rekonstruiert wird. Es gibt schon einen Plan, einen Grundriss oder eine Ansicht, die es ermöglicht, das Objekt einer Rekonstruktion zu unterwerfen. Ranulph Glanville schreibt dazu: „Die Schwierigkeit liegt darin, zu entscheiden, ob die Einsichten, zu denen wir gelangen können, davon abhängig gemacht werden sollten, ob sie mit den Instrumenten behandelt werden können, über die wir bereits verfügen.“
In medias res oder ab ovo? Wenn wir mit Sprache auf ein Kunstwerk reagieren, dann ist Sprache der Versuch einer Re-Konstruktion. Was wir in Sprache ausdrücken, ist eine spezifische Art der Wahrnehmung, in diesem Falle eines Kunstwerks. Was die Sprache erzeugt, ist eine Rekonstruktion einer Konstruktion. Die ursprüngliche Konstruktion ist im „Bild“ der Sprache nur als Rekonstruktion zu erfassen. Dieses „Defizit“ der Sprache ist konstitutiv für die Kunstkritik: Wir verfehlen das Objekt des Werks bei jeder Annäherung. „Etwas, das beobachtet werden kann, wird ein Objekt genannt. Behauptet wird, ihm eigne das Attribut der Beobachtbarkeit, weil es, indem es sich selbst beobachtet, beginnt, das Universum der Beobachtung seiner selbst zu bewohnen.“ so Glanville. Das Ergebnis kann nur die Rekonstruktion der sprachlichen Konstruktion sein, mit einer großen Portion Skepsis. Gegenüber der Dimensionalität des Kunstwerks ist die Sprache nur ein Behelf. Aber es gibt Fluchtwege und Notausgänge, zum Beispiel in der vorgegebenen Länge einer Kunstkritik: Raum ist in der kleinsten Hütte. Zum Beispiel in der Selbstdarstellung der spezifischen Kritik. So hat der Autor im Jahre 1992 eine Ausstellung im Rahmen der 37-Räume-Ausstellung in der Auguststraße arrangiert, die in der Präsentation von drei verschiedenen Kunstkritiken aus drei unterschiedlichen Kunstmagazinen bestand: Die Ausstellung zeigte diese Kunstkritiken, hochgezogen auf das Format 80 °— 60 cm im Rahmen. Die jeweiligen Kritiken wurden in den Kunstmagazinen „Texte zur Kunst“ (damals Köln), „Forum international“ (Brüssel, nicht mehr existent) und „Zyma“ (Stuttgart, nicht mehr existent) nicht veröffentlicht. Der selbstreferentielle Gestus aber ist kein Weg aus dem Dilemma.
Tatsächlich geht es darum, die Buchstaben beim Wort zu nehmen: es gibt eine unüberbrückbare Distanz zwischen Kunst-Werk und Wort. Eine angemessene Antwort auf diese Diskrepanz wäre das „Kunst-Wort“. Das „Kunst-Wort“ aber ist kein Wort des Journalismus. Es ist der kränkelnde Bastard aus der Vereinigung von Literatur und Reportage. Zwischen diesen Extremen muss sich die Kunstkritik behaupten, im Feuilleton auf der vorletzten Seite. Leider hat diese Seite den unüberbrückbaren Nachteil, dass sie tatsächlich zumeist aus einer Seite besteht, im besten Falle, und dann nur an einem bestimmten Wochentag. Diese Seite soll im Falle der Stadt Berlin ein konkretes Abbild der zeitgenössischen Kunst bieten. Keine Chance! Also muss sich der Kunstfreund bzw. die Kunstfreundin sowohl alle Tageszeitungen besorgen und wenn möglich noch die unterschiedlichen Kunstmagazine. Das gilt für den Rezipienten, für den Autor und Textproduzenten ebenso. Und er wird schnell feststellen müssen, dass es auch für ihn Hürden gibt: da fehlt der Platz, da missfällt der Text, da findet das konkrete Angebot, diese Ausstellung, keine Antwort, keinen Ort. Breite und Vielfalt sollen vermittelt werden, aber das bleibt eine Chimäre.
Wünschenswert wären Urteile, die ihre Begründung in der Person des Autors finden, ohne persönlich zu werden. Je klarer die Urteile, um so besser die Widerworte und die Abwehrmechanismen. Und umgekehrt, sei hier hinzugefügt. An den Urteilen sollen Vorprägungen und Traditionen aufscheinen, ebenso wie Prägungen oder Einflüsterungen: objektivierbare Meinungen einer spezifischen Person. Am Ende sollte der Leser entweder genauso klug sein wie der Autor oder noch ein bisschen klüger. Aber Urteile, positiv oder negativ, finden kaum Raum im Feuilleton, weil die Hymne dann doch zu spät kommt oder der Verriss keinen Platz mehr finden will. Wer will der Veröffentlichung seiner Texte hinterherrennen, wenn die Aussicht auf Publikation von vornherein in Frage gestellt ist.
Ein Ausweg bleibt: die Veröffentlichung in einem Blog. Das hat den schönen Vorteil, dass man zum Teil Herr im eigenen Haus ist und die Ansprache schön direkt sein kann. Die Publikation erscheint nicht am nächsten Tag auf schnödem Papier, sondern am späten Nachmittag digital nebst Einblicken in die jeweilige Ausstellung. Im Falle eines Falles kann auf kritische Einwürfe gleich geantwortet werden. Bei einem eigenen Blog ist die gewählte Form schon der Entwurf eines Inhaltes. Der Betreiber ist verantwortlicher Herausgeber, Redakteur und Autor in einer Person. Für einen fremden Blog zu schreiben, kann von Bedeutung sein, weil hier Form, Inhalt und Zugänglichkeit der Kunstkritik neue Wege öffnen können, die das Feuilleton noch nicht kennt oder kennen will: Rekonstruktion als Konstruktion als …