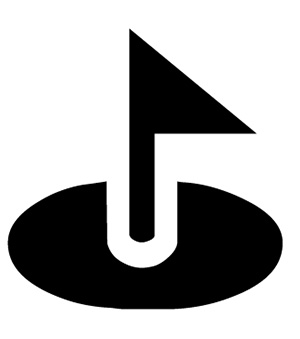Inklusion-Exklusion-Spezial
Eine Einführung
2017:September //
Kürzlich warf mir ein alter Freund im Streit meine Arroganz vor. Es handelte sich um eine Arroganz einer spezifischen Person gegenüber und mir war sie durchaus bewusst. Mein Freund lieferte gleich noch die Definition von Arroganz mit, nämlich das Empfinden, dass das eigene Wertesystem einem anderen gegenüber überlegen sei. Und ich gebe zu, es passiert mir häufiger.
Tatsächlich halte ich diese Definition für etwas zu weit gefasst, denn in letzter Konsequenz dürfte man dann gar kein Wertesystem mehr haben oder es nicht mehr verteidigen, sich nicht mehr für seine Werte einsetzen und am Ende wären sie nichts mehr wert, weil das Gegenteilige genauso viel wert wäre. Und letztletztendlich wäre sein Vorwurf mir gegenüber selbst arrogant.
Aber im Prinzip hat er Recht und mit der Frage „Wie arrogant bist du eigentlich?“ landet man direkt im Themenkomplex Inklusion/Exklusion. Jedes Ausschließen anderer könnte man auch als arrogant bezeichnen. Egal wer wem gegenüber. Vielleicht bringt es ja was, hier alle möglichen Gruppen aufzuzählen und sich die Haltung der einen den anderen gegenüber vorzustellen. In beide Richtungen. Fahrradfahrer/SUV-Fahrer, Ostler/Westler, Mütter/Nichtmütter, Chris Dercon/Frank Castorf, Linke/Rechte, Künstler/Nichtkünstler, Projektraumbetreiber/Galeristen, Hausbesitzer/Hausbesetzer, Heteros/Homos, Kulturgrafikdesigner/Dienstleistungsgrafikdesigner, Alteingesessene/Zuzügler, Judith Hopf/Jorinde Voigt, Berliner/Nichtberliner, Apple/Microsoft, Klimaschützer/Vielflieger, Maler/Konzeptkünstler, TzK/Monopol, Raimar Stange/Hanno Rauterberg usw. … endlos fortsetzbar, da schwirrt eine Menge Arroganz hin und her.
Wenn man die drei Stunden auf der Pressekonferenz der documenta in Kassel durchgehalten und alle Beiträge mitgehört hat, bleibt ein merkwürdiges Gefühl zurück. Da wird viel Toleranz gepredigt, viel Gender überwunden, der Ko-Kurator und SAVVY-Contemporary-Raum-Betreiber Bonaventure bringt sogar den tollen Begriff des „DisOther“ auf, und meint damit, dass man das Andere nicht außerhalb, sondern in sich aufspüren sollte, und damit wäre man vielleicht auch seine Arroganz los. Aber das merkwürdige Gefühl kommt daher, dass von dort oben soviel Antihierarchisches gepredigt wurde und das System der documenta per se eines der hierarchischsten im Kunstbetrieb ist, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Oder besser, dass Exklusion von allen betrieben wird, auch von den linken, superinklusiven, genderkorrekten, antikolonialistischen Biennalekunstbetriebsmackern und -mackerinnen. Dass solche Leute genauso gut durch andere hindurchschauen können wie hardcoreneoliberale Kunstmarktgaleristen, weiß man spätestens seit dem Aufstieg ehemaliger „Botschafts e.V.“-Künstler in höhere Biennale- oder documentasphären. Der linke, diskursive Kunstbetrieb, nicht nur der um „Texte zur Kunst“, ist ein ausschließender.
Und das könnte das Problem der Linken insgesamt sein. Und so wird das auch von der neu erstarkten Rechten formuliert, dass das scheinbar so tolerante linke Milieu die Meinungshoheit gepachtet habe, ja, eine Meinungsdiktatur darstelle und alle Andersdenkenden unterdrücke und nicht abbilde, vorneweg die linksliberale Lügenpresse. Das machte der jüngste Streit um das Buch „Finis Germania“ deutlich. Darf man so ein Buch auf die jurierte Bestensachbuchliste hieven und ihm damit Werbung verschaffen oder nicht? Genau deswegen landen wir Linken bei den postulierten Werten Toleranz und Gleichheit in einer Zwickmühle, weil wir gleichzeitig nichttolerante Menschen ablehnen und ausschließen. Ein nichtlösbarer Konflikt. Aber deshalb müsste man sagen, fuck it, dann gibt es eben Arroganz, eine Welt ohne Ein- und Ausschluss ist nicht möglich, es wäre eine Welt ohne Kriterien. Lasst uns lieber streiten.
Natürlich leben wir alle in Gruppen und Gemeinschaften, neben anderen Gruppen, die anders sind, und die wir auch doof finden dürfen. Ich bin zum Beispiel Teil einer selteneren Spezies, nämlich ein linker Golfspieler, zudem Künstler. Normalerweise spiele ich mit meinesgleichen, mit anderen Künstlern und ähnlich denkenden Freunden, bin Wochentagsmitglied, das heißt, ich spiele nur unter der Woche und verabrede mich. An den Wochenenden sind alle anderen da und treffen sich in Turnieren mit meist zufällig ausgewählten Mitspielern. Irgendwann kennen sich dann alle anderen und es entwickelt sich samstags und sonntags eine Art Vereinsleben. Uns kennt kaum einer. Wir sind so etwas wie der schwarze Block des Golfclubs. Kürzlich wurde ich aufgrund meines mittelguten Handicaps gefragt, ob ich nicht in der Jungseniorenmannschaft (immerhin Altersklasse 30–50, in drei Jahren wäre ich in der Seniorenmannschaft) mitspielen möchte. Man spielt dann ein, zweimal im Jahr gegen alle anderen Jungsenioren der ungefähr 20 Vereine in Berlin und Brandenburg. Und ich sagte zu. Beim regelmäßigen Mittwochabendtraining war ich nur einmal da und absurderweise als einziger außer dem Trainer anwesend, ich kannte mein Team also gar nicht. Schließlich war es dann soweit und was soll ich sagen, ja, der normale Golfer ist irgendwie anders als ich. Auf dem ganzen Golfplatz tummelte sich eine enorme Menge an Testosteron. Mein Mannschaftskapitän war Major oder Oberstleutnant der Bundeswehr und schaute am Vorabend eine Folge „Game of Thrones“, um sich vorzubereiten. Andreas, sagte er mir, jetzt ist Krieg.
Männlich, weiß, sehr geringer Migrationhintergrundsanteil, gutverdienend, aber einen Tuck prollig. Bier, Frauenwitze, Autos, Apps und lustige Verkleidungsfotos auf dem Grün. Kernige, schlagfertige Zoten machten die Runde. Vielleicht wäre Donald Trump hier auf dem Golfplatz auch Präsident geworden, stünde er zur Wahl. Auf jeden Fall hat er bestimmt jede Menge versteckter und offener Bewunderer, und dazwischen stand nun ich …
Aber, was soll ich sagen, ich liebe diesen Sport, ich bin auch weiß, männlich, ohne Migrationshintergrund. Lach ich halt nicht mit, trotzdem bin ich an diesem Tag Teil dieser sehr speziellen Spezies mit Schläger in der Hand und genieße es auch. Ähnlich wie das achtzehnjährige Mädchen, das letztes Jahr von Kreuzberg nach Trumpistan in Minnesota verschickt wurde, zum Schüleraustausch als links-sozialisiertes Wesen. Sie verbrachte ein Jahr alleine inmitten von zutiefst fundamental-christlichen Trumpfans und verfasste darüber einen der meistgelesenen taz-Beiträge. Jetzt reiste sie nochmals zu Besuch zurück und traf ihre mittlerweile Freunde von dort. Eine Erkenntnis, die sie hatte, war tatsächlich, dass die Gastfamilien ihr gegenüber toleranter waren als sie zu ihnen …
Vielleicht also doch öfter die Abgrenzungen aufgeben, ohne konturlos zu werden? Was dabei helfen könnte, wäre erstmal, weniger zu wollen. Weniger gelten zu wollen, weniger Recht haben zu wollen, weniger Geld besitzen zu wollen, weniger Platz haben zu wollen, weniger cool sein zu wollen.
Sagt natürlich der Richtige, sagen jetzt manche. Muss man natürlich trainieren. Da ist aus dem kapitalistischen Hamsterrädchen auszusteigen noch die leichteste Übung. Schwieriger wird’s mit der Eitelkeit über das eigene Tun, und der eigenen Arroganz, an der man sie bemerkt. Diese könnte als Gradmesser dienen. Fühl ich mich überlegen und warum? Erst mit mehr Demut wird man auch inklusiver. Auf dem Golfturniertag wurde ich übrigens von einem 30-jährigen Sportlehrer gnadenlos demontiert …