Tod-Spezial
Nachlässe
2025:Juni //
Kleinere Nachlässe benötigen möglicherweise nur einen Raum von 10 m² oder weniger, wenn es sich um eine Anzahl von bis zu 500 kleineren und mittleren Werken auf flachen Bildträgern handelt oder gar um Zeichnungen. Ein mittlerer Nachlass mit bis zu 2.000 Arbeiten auf flachem Bildträger oder eine Mischung aus flachen Bildträgern und skulpturalen Anteilen kann schnell um die 50 m² bis zu 100 m² reine Lagerfläche umfassen. Dann gibt es noch die großen Nachlässe, von Künstlerinnen und Künstlern, die sehr produktiv gewesen sind, gerne mit mehreren Tausend Einheiten aller Formate, mit massivem Raumbedarf, die dann häufig auch ausgestattet sind mit den nötigen finanziellen Mitteln, um den Nachlass entsprechend zu betreuen. Eine ideale Betreuung besteht aus sicherer Lagerung, professioneller Archivierung und Katalogisierung mit anschließender kunstwissenschaftlicher Aufarbeitung und Vermittlung. Das wird den allerwenigsten Nachlässen in vollem Umfang zuteil.
Wenn man von einem eher durchschnittlichen Bedarf an Raum ausgeht und sagt, dass 50 m² ausreichen müssen, um ein gesamtes Lebenswerk unterzubringen, von dem nicht so richtig viel in den ersten Kunstmarkt gelangt ist, dann wäre das bei 600 Toten im Jahr ein Raumbedarf von 30.000 m², also in etwa so viel wie die gesamte Verkaufsfläche des Einkaufszentrums Alexa in Berlin-Mitte. Jedes Jahr. Innerhalb eines Jahrzehnts wäre der Bedarf für Deutschlands Kunstwerke verstorbener Künstler dann also zehn Alexas. Vollgestopft mit Kunstwerken, die, man muss es leider so klar sagen, künftig überwiegend niemanden mehr interessieren werden, die überwiegend nicht mehr ausgestellt werden, die dem Vergessen übergeben werden, die aber von den Hinterbliebenen aus sehr unterschiedlichen Gründen auch nicht einfach auf den Müll geworfen werden können.
Glücklicherweise fallen nicht alle Nachlässe in Berlin oder München an, wo die innerstädtischen Lagerkosten schon so hoch sind, dass sich das schon Lebendige nicht mehr leisten können. Wenn man mal den durchschnittlichen bundesdeutschen Preis pro Quadratmeter Lagerfläche von 4,50 bis 7,50 Euro (pro Monat) anschaut und davon ausgeht, dass mindestens die Hälfte, wenn nicht die Mehrheit der sterbenden Künstlerinnen und Künstler in urbanen und nicht in ländlichen Gebieten wohnen, dann könnte man von grob geschätzten jährlichen Gesamtausgaben von 30.000 × 6,00 Euro × 12 Monate = 2.160.000 Euro ausgehen.
Viele Hinterbliebene werden daher vor schwierigen Entscheidungen stehen, ob das Werk der Verstorbenen erhaltenswert ist oder nicht. Wenn es keinen relevanten Marktwert hat, was soll man dann damit anfangen? Man kann einzelne Arbeiten entnehmen, was aber passiert mit dem Rest? Man muss sich einerseits über die persönliche Bindung zum hinterlassenen Werk klar werden, andererseits muss eine Einschätzung her über das künftige Potenzial. Kann man davon noch etwas monetarisieren? Oder ist der Nachlass trotz ausgebliebenen Erfolgs in irgendeiner Weise kulturell wertvoll und sollte deshalb erhalten werden? Wenn ja, wie stellt man das an, wer unterstützt einen dabei? Wer zahlt das? Braucht man eine kunsthistorische Expertise oder muss das Werk katalogisiert und archiviert werden? Was aber, wenn es tatsächlich künstlerisch eher mittelmäßig oder gar minderwertig ist, man aber trotzdem eine starke emotionale Bindung verspürt? Ein Haufen schwieriger Fragen.
Man könnte für die Einordnung der Chancen des Erhalts von Nachlässen etwa diese Kategorien aufstellen: Der Nachlass von erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern wird von Museen, Sammlungen und Galerien betreut und verwertet, die Wertschöpfung hält an, verstärkt sich womöglich nach dem Ableben sogar noch. Bei weniger erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern wird es schon schwieriger, die Werke sind womöglich in einigen Sammlungen vertreten, aber nicht im Top-Ranking, das Werk kann schnell in Vergessenheit geraten, wenn keine aktive Wertschöpfung mehr möglich ist. Der Anreiz zur Betreuung aus dem ersten Markt sinkt, institutionelle Player müssten an diese Stelle treten, um das Werk vor dem Verschwinden zu retten. Ganz schwierig wird es leider bei wenig sichtbaren oder gar völlig erfolglosen Künstlerinnen und Künstlern. Außer dem nächsten privaten Umfeld wird sich niemand für das Werk interessieren. Gibt es keine Präsenz in relevanten privaten oder öffentlichen Sammlungen, dann gibt es weder Sichtbarkeit noch Wertschöpfung. Das Werk besitzt nur noch einen emotionalen Wert und stellt die Hinterbliebenen vor unschöne Entscheidungen.
Es gibt in Deutschland einige Institutionen, die sich der Pflege von künstlerischen Nachlässen widmen. Das Verfahren für eine Aufnahme eines Nachlasses könnte man am ehesten mit der Bewerbung um ein Stipendium vergleichen. Voraussetzung zur Aufnahme ist die Beurteilung durch Jurys, die das jeweilige Werk als erhaltenswert einstufen. Die Stiftung Kunstfonds betreut zum Beispiel nach eigenen Angaben 50.000 Positionen bildender Künstlerinnen und Künstler in einem 2.000 m2 großen Archivgebäude in der Nähe von Köln. Klingt nach einer recht geringen Chance für XY.
Eine einschlägige Studie von 2018 geht davon aus, dass zwischen 10.000 und 15.000 künstlerische Nachlässe in irgendeiner Form in Deutschland existieren, davon werden zwischen 3.000 und 5.000 professionell betreut, also in Archiven, Museen oder durch Stiftungen. Mit geschätzten 50.000 bis 60.000 Nachlässen in Deutschland innerhalb von 100 Jahren ist diese Zahl eher gering.
Die Hinterbliebenen müssen dieser Realität ins Auge sehen, häufig läuft es dann auf eine Reduktion auf vielleicht 10 % des ursprünglichen Werks hinaus. Nur die besten Arbeiten werden archiviert, in irgendeiner Weise selbst genutzt oder verschenkt, was den Raum- und Betreuungsbedarf drastisch verringert.
Also doch schon vorher sichten und vernichten?
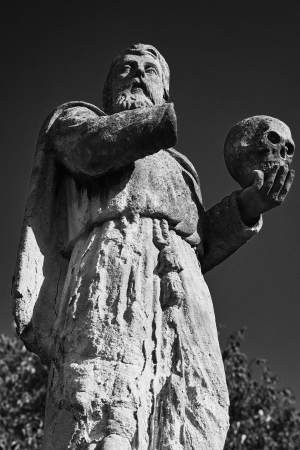
Foto: Nadine Dinter, Cimetière Central, Arles, 2024