Tim Voss
Ein Gespräch über Freundschaft
2025:Juni //
Tim Voss ist Kurator, ich kenne ihn noch aus Hamburg, wo er an der Hochschule für Bildende Künste studiert und dort mit dem Kuratieren angefangen hat: zunächst im Projektraum Hinterconti, dann in der Galerie der HFBK und im Kunstverein Harburger Bahnhof, worauf Stationen in Amsterdam, Worpswede und Wien folgten. Seit Januar 2024 arbeitet er für die Berliner B.L.O.-Ateliers als Projektkoordinator und daneben als Coach und Berater. Wir treffen uns mehrmals bei ihm zu Hause, wo er mit seiner Partnerin Lily und ihrem gemeinsamen Kind wohnt, zum Mittagessen und reden dabei über Freundschaft.
Anna-Lena Wenzel: In Hamburg haben wir uns eher im Blick gehabt, als befreundet zu sein. Ich weiß noch, dass ich sehr überrascht war, als du mich mal für einen Job empfohlen hast. Ich hatte nicht gedacht, dass du mich auch auf dem Schirm hast, während du durch deine Arbeit als Kurator präsent warst. Dann haben wir uns letztes Jahr hier in Berlin bei einer Eröffnung wiedergesehen und du hast mich kurzerhand auf dem Roller nach Hause mitgenommen, weil wir quasi Nachbarn sind. Seit dem sehen wir uns ab und zu – und sprechen heute erstmals über Freundschaft.
Es gibt dieses Buch über Freundschaft von Isabelle Graw, in dem sie die These aufstellt, dass im Kunstfeld funktionale Freundschaften dominieren. Dem gegenüber proklamiert die Dramaturgin und Kuratorin Felizitas Stilleke, dass sie nur ihre Freund*innen kuratiere. Wie ist deine Erfahrung? Wie bist du mit der Macht umgegangen, die du als Kurator hattest?
Tim Voss: Ich habe am Ende des Abends oft den Boden mitgefegt, aber habe zunehmend Erfahrungen gemacht, dass mir flache Hierarchien bei Problemen auf die Füße fallen können, und ich bin vorsichtiger geworden. Verantwortung anzunehmen, die mit der Leitungsposition einhergeht, heißt wohl auch, Distanz zu wahren, aber authentisch zu bleiben. Also, ja: Der Kunstbetrieb ist auch meiner Erfahrung nach von funktionalen Freundschaften geprägt. Da muss man aufpassen, das nicht zu verwechseln. Möchtest du noch einen Kaffee?
ALW: Gern. Haben sich deine Freundschaften verändert, als du über die Sichtbarkeit anderer entscheiden konntest?
TV: Es war ein Prozess. In der Galerie in der HFBK war ich noch einer von ihnen, aber mit dem Wechsel an den Kunstverein Harburg war damit schnell Schluss. Da geriet ich mit meinem Idealismus schnell zwischen die Stühle und wurde ganz schön auseinandergenommen. Ich weiß noch, wie abgefahren ich es in Amsterdam fand, dass mir dort alle Türen offenstanden. Die Künstler*innen waren froh, wenn ich sie in ihren Ateliers besuchte. Ich war für sie halt der Schlüsselmeister zu einer Institution. Da entstanden schnell freundschaftliche Gefühle. Im Kunstbetrieb dominiert ja der radikal individualisierte Betrieb unter völlig intransparenten Bedingungen: Höhe mal Breite mal Künstler*inkoeffizient macht den Wert eines Bildes. Um als Künstler*in in eine Galerie zu kommen hilft es, sich an die Codes einer funktionalen Freundschaft zu halten. Diese Daumen-Hoch- und Herzchen-Freundschaft, die wir aus den sozialen Medien kennen.
ALW: Du meinst, dass Freundschaft da eher ‚performt‘ als gelebt wird? Das klingt jetzt arg pessimistisch …
TV: Natürlich wollte auch ich mit Menschen arbeiten, die ich gerne habe. Aber das ist nicht unproblematisch, wie Felizitas Stillecke bemerkt. Schließlich geben wir auch öffentliche Fördermittel aus. Generell gerät eine ‚professionelle‘ Freundschaft schnell unter Druck, denn die Interessen einer Institution, eines Kurators sind ja nicht deckungsgleich wie die der Künstler*innen. Bei mir gab es oft Spannungen, auch Streit, in den kuratorischen Prozessen. Nur in Harmonie kam ich meiner Erfahrung nach nur selten zu den besten Ergebnissen. Ich habe das Problem darüber gelöst, dass ich versucht habe, mich voll auf die Kunst meines Gegenübers einzulassen, in einem kritischen Verhältnis, in dem es ‚um die Sache‘ geht. Am Ende dieses gemeinsamen Commitments entstand da schon oft ein Gefühl echter Freundschaft.
ALW: Ich kenne das aus meiner Arbeit. Ich kann in relativ kurzer Zeit eine intime Atmosphäre herstellen – wenn ich ein Interview für einen Artikel mache oder bei einem Atelierbesuch –, sodass sich das Nähe-Herstellen auf eine Art professionalisiert und auch funktionalisiert hat. Aber das würde ich nicht als Freundschaft bezeichnen.
TV: Es waren Freundschaften für den Moment. Nach meiner Leitung des Wiener Künstlerhauses wollte ich so nicht mehr arbeiten. Als ich dann ausgestiegen bin und keine Produktionsmittel mehr zur Verfügung hatte, war ich trotzdem überrascht, wie wenige Freund*innen aus diesem Umfeld übrig geblieben sind. Überrascht vielleicht weniger über den Verlust von Freundschaft, sondern mehr über den Verlust von Freundlichkeit generell. Freundlichkeit wird im Kulturbereich oft darüber sanktioniert, wer einen weiterbringen kann.
ALW: Aber sind da nicht auch an allen Stationen, an denen du warst, Freund*innen dazugekommen?
TV: Doch, es gibt auch dauerhafte Freundschaften, die auch jetzt noch bestehen. Erzähl mir noch mal ein bisschen mehr über dein Buch.
ALW: Ich beobachte ein Ungleichgewicht zwischen Freundschaften und Paarbeziehungen bzw. Familienkonstruktionen, obwohl ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass die Grenzen zwischen ihnen fließend sind. Ich glaube, dass durch feministische und queere Ansätze verstärkt Modelle entstehen und lebbarer werden, die offener funktionieren als klassische Paarbeziehungen. Ich bin neugierig herauszufinden, wie andere das empfinden und wie sie das definieren.
TV: Ich hab mal in Hamburg mit zwei Freunden zusammengewohnt, die ein Paar waren. Das würde ich nie wieder tun, weil bei allem Wunsch, eine Freundschaft auf Augenhöhe zu dritt zu haben, die beiden über alles schon eine Kommunikation gehabt haben. Das war ein Ungleichgewicht, in dem ich gelernt habe, vorsichtiger im Umgang mit Pärchenkonstellationen zu sein. Dann müssen die mich in ihr Bett lassen oder irgendwas, um das aufzubrechen. Ich bin dafür nicht der Typ, aber es wäre ein Möglichkeitsraum, um das noch mal zu hinterfragen.
Wir haben das Wort Freundschaft aber immer noch nicht gefasst. Ich hätte schon den Reflex nachzufragen, was meinste denn damit? Ist das so eine Facebook-Friendship oder ist es Freundschaft in der analogen Form eines 55-Jährigen? [schmunzelt]
ALW: Ich finde es interessant, Freundschaft als Lebensweise zu denken, als eine Art des gesellschaftlichen Seins und eine Form des Miteinanders. Dabei geht es auch um eine Haltung in der Welt und im Verhältnis zu meiner Umwelt. Es ist kein Zufall, dass du für deine Nachbarn einkaufst. Ich nehme dich als jemanden wahr, dem es ein Anliegen ist, soziale Situationen zu schaffen und Leute zusammenzubringen. Für Urbane Künste Ruhr und das ZK/U in Berlin hast du ein Format entwickelt, bei dem du in einem mobilen Küchensetting gemeinsam mit Künstler*innen kochst und mit ihnen über ihre Kunst sprichst. Zudem veranstaltet ihr regelmäßig Essen bei euch zu Hause …
TV: … aber diese Essen pausieren gerade. Beim letzten Mal gab es eine Diskussion über die aktuelle Situation in Nahost, das ist total ausgeartet. Ein Freund hat so stark auf seiner Meinung beharrt, dass er dafür unsere Freundschaft aufs Spiel gesetzt hat, so etwas möchte ich nicht noch mal erleben.
ALW: Ich höre gerade von vielen Seiten, wie dieses Thema Freundschaften belastet. Es ist ein Drahtseilakt: unterschiedliche Meinungen zu haben und gleichzeitig solidarisch sein zu wollen, ein offenes Ohr zu haben und doch seine Meinung zu vertreten. Konflikte können ja auch eine Intensität reinbringen, aber wenn sie die Freundschaft gefährden, wird es heikel.
TV: Ich habe im Angesicht der auftauchenden Krisen den Eindruck, dass Selbstorganisation und Verbundenheit wesentliche Bedürfnisse sind. Der Wunsch, sich zu verbinden und das möglichst selber gestalten zu dürfen. Letztes Jahr haben wir unser Wohnhaus im Vorkauf zurückerobert und sind darüber zu einer funktionierenden Hausgemeinschaft geworden. Mit in Hochphasen wöchentlichen Plena, soziokratisch moderiert. Wir hatten am Ende einen Abend, das nannte sich „Warme Dusche“, kennst du das?
ALW: Nein.
TV: Der Hammer. Wir haben drei Monate jeden Montag zusammengesessen. Und dann gab es am Ende einen Punkt, wo alles klar war – Haus war gekauft mit Hilfe einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft – und dann hat die Moderatorin gesagt: Stopp Leute, bevor wir auseinandergehen, müssen wir eine „Warme Dusche“ machen. Das funktioniert so, dass alle sagen, warum sie es gut fanden – nur gut – mit dir zu arbeiten. Viele fingen an zu weinen, als sie dran waren. Danach war eine Energie im Raum, so etwas habe ich noch nie erlebt. Das war so eine Wertschätzung und so eine Verbundenheit.
ALW: Tatsächlich habe ich mich nach unserem letzten Gespräch, in dem wir viel über die Vereinbarkeit deiner Arbeit als Kurator und Freundschaften gesprochen haben, gefragt, wie das mit Aktivismus und Freundschaft ist. Ist es hier einfacher als in der Kunst, Freundschaften zu kontinuieren und zu pflegen, oder ist es genau so flüchtig, weil man eine gemeinsame Aktion macht oder ein gemeinsames Ziel hat, wie hier im Falle der Abwendung des Verkaufs des Hauses, und dann wieder auseinander geht?
TV: Durch Aktivismus kann schon Freundschaft entstehen. Andersrum ist es problematisch für die Bewegungsmomente der anderen, wenn man mit Freund*innen Aktivismus startet. Unsere Stärke war vor allem, dass wir vorher ein anonymes Haus waren und mit einem Beziehungs-Ground-Zero gestartet sind. Wir haben uns über das Aktivieren kennengelernt.
ALW: Ich glaube sofort, dass das ein starkes Miteinandergefühl produzieren kann, aber ich frage mich, wie nachhaltig das ist. Vielleicht ist es eher Gefährt*innenschaft?
TV: Hmm. Vielleicht ist das gar nicht weit weg von der Projektzusammenarbeit mit Künstler*innen. Hans Christian Dany beschreibt das für die Kunst so gut: Vieles fängt lustig an, bis der Spaß plötzlich aufhört und sich alle streng ansehen. Auch eine echte Hamburg-Erfahrung. Apropos Hamburg: Wie ist es bei dir mit Hamburg? Es gibt da so eine Handvoll Leute, die ich als Freund*innen bezeichnen würde – im Sinne eines aktiven Austausches.
ALW: Bei mir ist es anders. Ich habe nur noch ganz wenige Freund*innen in Hamburg, es gibt so viele, die hier nach Berlin gekommen sind. Außerdem bin ich meistens bei meiner Mutter und nicht mehr unterwegs.
TV: Das ist tatsächlich etwas anderes, wenn das zur Familienstadt wird. Durch Tilman, bei dem ich meistens übernachte, bekomme ich immer erzählt, was gerade in Hamburg abgeht.
ALW: Ja, wenn man bei einem Freund übernachtet, hat man eine andere Form der Begegnung, als wenn man die Freund*innen nur kurz auf einen Café trifft.
TV: Wenn man das Thema Freundschaft weiter fasst, als Wunsch nach Verbundenheit, dann frage ich mich, ob die Menschen das durch soziale Medien kompensiert bekommen?
ALW: Gute Frage. Oberflächlich ja schon. Ich habe gestern einen Freund getroffen, der darauf hinwies, dass da die ganze Zeit Dopamin fließt, wenn du Likes bekommst und etwas aufploppt. Das ist ein starker Affekt, aber es trägt dich nirgendwo hin.
TV: Wie bei so vielen Dingen mag es helfen, die sprachliche Vereinbarung ‚Freundschaft‘ für ein Verhältnis als nicht statisch zu denken, sondern als durchgehende Performance. Einer gemeinsamen Zuwendung durch die Zeit hindurch. Und einer Art von Synchronizität der Konstitution meines Gegenübers und der meinigen. Ich bin aber gespannt, wie junge Menschen, die mit sozialen Medien groß geworden sind, das für sich bestimmen werden.
ALW: Aber die müssen ja auch mal zum Arzt gehen und brauchen jemanden, der sie begleitet oder ihnen beim Umzug hilft! Wobei ich denke, dass sich das nicht ausschließen muss: Der Austausch, der über Social-Media passiert, kann ja auch ein reales Äquivalent haben.
TV: Also ein Herzchen zu bekommen und damit Freundschaft zu machen, ist mir zu leicht. Ich selber sehe meinen Freundschaftsbegriff immer wieder scheitern oder unbefriedigt erfüllt, weil ich es nicht hinkriege, jemanden konsequent dasselbe Care zu bieten, wie ich es gegenüber Lily tue.
ALW: Hat das damit zu tun, dass eine Beziehung einen Rahmen bietet, in dem Care-Arbeit selbstverständlich ist? In Freundschaften muss dieser Rahmen erstmal ausgehandelt werden. Eine Krankheit, die Care-Arbeit erfordert, ist ein Anlass über das übliche Freundschaftsmaß hinauszugehen.
TV: Ja, bei einer Freundin, die letztes Jahr gestorben ist, wurde in dem Moment, in dem sie so krank geworden ist, relativ schnell klar, wer wirklich verbindlich da ist, mit ihr zum Arzt geht, für sie einkauft und die unangenehmen Fragen stellt. Die Frage, die man sich stellen kann, ist: Wen würde ich anrufen, wenn ich in so einer Notsituation bin? Da nicht sofort eine Antwort zu finden, macht sehr unruhig. Daran schließt sich die Frage an: Wie können wir ohne die Dringlichkeit einer Krankheit einen Alltag miteinander organisieren? Ich beklage mich oft über die Männer, denen das so schwer fällt, und merke daran, dass ich auch so bin. Es scheint Frauen einfacher zu fallen, diese Nähe aufzubauen. Das ist offensichtlich gegendert, wir Männer sind da anders sozialisiert, vielleicht auch konstituiert. The lonely wolfs …
ALW: Beim letzten Mal hattest du den Begriff „Kumpel“ eingebracht, der für mich auch klar gegendert ist. Als ich mit Michael [Hirsch] darüber gesprochen habe, hat er bestätigt, dass bei Männern generell öfter ein Konkurrenzding mitschwingt.
TV: Interessant. Warum?
ALW: Bei Männern geht es öfter um ein Vergleichen.
TV: Komisch. Ich nehme diese Spannung zwischen Männern wahr, aber ich habe sie nie als Konkurrenz gelesen. Eher so als Sprechen über scheinbar Rationales, bei dem die Emotionen aber im Hintergrund arbeiten. Es gibt zwar so etwas Gockeliges, aber Konkurrenz gibt es doch auch unter Frauen.
ALW: Das stimmt.
TV: Ich habe gar nicht so richtig eine Vorstellung von Konkurrenz, was natürlich nicht ausschließt, dass ich sie nicht empfinde. Ich merke aber, dass mich Konkurrenz selten weiterführt. Marshall Rosenberg unterscheidet zwischen Gefühlen und Pseudo-Gefühlen, und Konkurrenz ist ein klassisches Pseudo-Gefühl. Du kannst empfinden, dass die andere Person über dich drüber geht, du kannst empfinden, dass du deinen Punkt nicht genug machen kannst, du kannst dich bedrängt fühlen von dem anderen. Aber bei Konkurrenz steckt schon im Begriff, dass du mit dem nicht handeln kannst. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es sich eher um Projektionen handelt: Du begegnest jemand, und der ist dir total ähnlich, und das ruft eine Abwehr hervor.
ALW: Ja, das kenne ich! Dass jemand einem die eigenen negativen Seiten so krass spiegelt, dass man sich abwendet.
TV: Das kann man als Konkurrenz bezeichnen, aber das hilft dir null. Du musst dahin, wo es wehtut, zu den echten Gefühlen und Bedürfnissen. Du musst dich fragen, was du in der anderen Person siehst, was dir unangenehm ist. Da gibt es eine Selbsterkenntnis.
Ein Freund gibt mir die Möglichkeit ein positives Verhältnis zu dem zu haben, was der andere in mir spiegelt. Oder die Möglichkeit das zu besprechen. Es ist nicht toxisch, sondern wird Teil von einer Gemeinsamkeit, Ausdruck von Verbundenheit.
ALW: Ich finde interessant, wen man sich als Freund oder Freundin aussucht und was dabei eine Rolle spielt – Attraktivität oder Wertschätzung? Warum ist jemand interessant, warum möchte man mit ihm verbunden sein?
TV: Krass ist ja, dass das Verknalltsein das egomanste Gefühl ist, das man haben kann, weil du dich regelrecht berauschst darin, begehrt zu werden, das ist eine riesige Narzissmustunke. Lange hatte ich Beziehungen immer drei Wochen lang. Sobald irgendwas wie Verbindlichkeit reinkam, war ich weg.
ALW: Fiel das zusammen mit der kuratorischen Tätigkeit?
TV: Nein, das war früher in der Bauwagenzeit. Diese Bauwagen hatten ja alle Räder unten dran, am schlimmsten waren die Travellers, die mussten nur den Motor anschmeißen und weg waren sie. Gleichzeitig wurde nirgendwo so viel über Verbindlichkeit und Freundschaft gesprochen wie dort.
ALW: Das klingt paradox und bringt mich zu einer anderen Frage: Hast du Vorbilder für diese Art des offenen Hauses, das ihr habt? Ein Bauwagenplatz ist ja auch ein soziales Konstrukt, das sich von klassischen Familienmodellen und dem Einfamilienhaus abgrenzt.
TV: Ich hatte in meiner Familie irgendwann so einen Punkt, wo ich gesagt habe, das ist total verlogen. Mein Vater ist zehn Jahre fremdgegangen, meine Mutter dachte, es ging nur um drei Monate. Das kam alles am Sterbebett heraus. Eigentlich war der Deal, sie bleibt zu Hause, er arbeitet immer. Ich habe da nie dran geglaubt und habe eine starke Abneigung gegen diese Zweierkiste.
ALW: Bei mir oder bei uns war das insofern anders, als mein Vater depressiv war und sich das Leben genommen hat. Da war ich 16. Für mich war das Bild, das ich von Beziehungen mitbekommen habe, eines, das oft spannungsgeladen war.
TV: War er auch so ein verpanzerter Mann, der wenig über seine Gefühle redete und so verschwunden ist?
ALW: Wahrscheinlich.
TV: Ich habe gemerkt, dass ich mit dem Freundschaftsbegriff meines Vaters struggle. Der war auch ein sehr verpanzerter Mann – mit vielen Gewalterfahrungen. Er war ein Flüchtlingskind und konnte sich persönlich nicht öffnen. Mein Freundschaftsbegriff sollte von der Idee her ein anderer sein, aber ich kam aus dem Kessel nicht heraus, in dem ich gemacht wurde: Ich erklärte jemandem die Freundschaft und zog dann aber doch von dannen.
ALW: Könntest du den Freundschaftsbegriff deiner Eltern noch etwas näher beschreiben?
TV: Meine Mutter war sehr sozial engagiert, die war immer im Kontakt mit anderen. Die war in der Gemeinde aktiv und so. Und die hat die Leute reingeholt und mein Vater hat es genossen. Aber er war da drin wie ein Block, es gab nur selten Momente einer körperlich hölzernen Zärtlichkeit. Er konnte nur über Alkohol locker werden und hat überhaupt nichts preisgeben. Über den Beruf konnte er reden, aber sonst war da nichts. Ich habe bis heute keine emotionale Selbsterzählung meines Vaters, die gab es nicht.
ALW: Das kommt mir sehr bekannt vor. Und du wolltest das anders machen? Dieses offene Haus hast du dann ja fortgesetzt. Auf eine Art gibt es da Kontinuitäten.
TV: Ich weiß nicht. Du hast noch einen Bruder, oder? Ist der auch ein Freund für dich?
ALW: Ja, sogar zwei. Ich würde sagen, dass es vor allem eine familiäre Beziehung ist, was auch viel mit meinen Neffen zu tun hat. Die sorgen für die Bindung oder sind Anlass für den Kontakt. Ich bin eine leidenschaftliche Tante. Ich finde das interessant, dass ich, obwohl ich die Freundschaften so hochhalte, in diesem Punkt – zum Beispiel wenn es um Weihnachten geht – relativ klassisch bin.
TV: Das finde ich auch immer wieder erstaunlich, wie konstitutiv diese Familien dann doch bleiben. Obwohl ich auch viele kenne, die mit ihrer Familie gebrochen haben oder ihre Geschwister nur alle paar Jahre mal treffen.
Was für mich richtig erschütternd war, war das Elternhaus aufzulösen. Dass dieser Ort verschwunden ist, war eine Zäsur. Da geht auch ein Stück eigene Sozialgeschichte verloren. Das musst du in dieser Satellitenform mit Freund*innen erst mal aufbauen, all diese ganzen Archive. Mit einem Bruder kannst du dich total zerlegen in Erbschaftsstreitigkeiten, und es bleibt bei allen eine riesige Wunde, wenn du das nicht geregelt kriegst, aber trotzdem bleibst du verbunden. Eine zerlegte Freundschaft dagegen …
ALW: Zerlegen sich Freundschaften oder laufen sie eher aus? Ich habe eigentlich keine, die im Streit zu Ende gegangen sind. Was auch damit zu tun hat, dass ich mich scheue, in die Konflikte reinzugehen.
TV: Ich bin heute Abend mit demjenigen verabredet, mit dem ich mich so zerstritten habe.
ALW: Ich bin gespannt, wie es ausgeht!
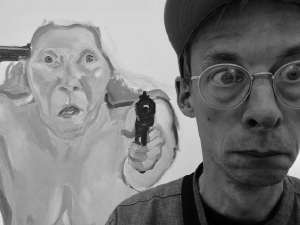
Foto: privat