Henning Lundkvist
Planned Obsolescene – Buchbesprechung
2019:September //
Neulich bei do you read me?! – Moment mal. Zwischen den vielen bunten, topdesignten Publikationen und Magazinen liegt ein schlichtes weißes Büchlein auf dem vollgepackten Auslagetisch, das man leicht übersehen könnte, wäre da nicht dieser lapidare Satz auf dem Cover:
„It is true that I had accumulated a lot of cultural capital, but like so many others I had never found a way to convert it into cash“
Ein solches Statement inmitten eines Zeitschriftenladens full of inspiring magazines, der bevorzugt von lifestyle addicts, fashionistas, influencern und der international contemporary art crowd frequentiert wird, gibt Anlass zur Verwunderung. Dieser Satz passt schlichtweg nicht ins Bild, besagt er doch nichts anderes als: Ich realisiere eine tolles Projekt nach dem anderen, investiere fortwährend mein Geld, meine Zeit und meine Energie, aber irgendwie kommt nicht ein Cent dabei rum. Ich schleppe kofferweise symbolisches Kapital durch die Gegend, aber es zahlt sich einfach nicht aus. Kurz gesagt: Es läuft überhaupt nicht, beziehungsweise etwas läuft ganz gründlich falsch. Ein derartiges Eingeständnis grenzt in „coolen Kontexten“ wie dem do you read me?! schon fast an Blasphemie. Denn vergebliche Bemühungen und gescheiterte Projekte werden im Kunstbetriebsmilieu normalerweise diskret kaschiert. Was zählt, sind Erfolge, eine gelungene Performance und die positive Selbstvergewisserung. Wer will sich schon mit Leuten abgeben, bei denen es nicht läuft?! Man spricht über Reinfälle – wenn überhaupt – nur hinter vorgehaltener Hand. Was ist das also für ein verrücktes Buch, das mit einem solchen Paukenschlag beginnt und noch dazu den fulminanten Titel „Planned Obsolescence – A Retrospective“ trägt?
Geschrieben hat es der schwedische Autor und Künstler Henning Lundkvist, und ihm ist auf 111 Seiten eine so unterhaltsame wie deprimierende Abhandlung über die Ökonomie des kulturellen Feldes und ihre Auswirkungen auf das Leben und Arbeiten seiner Akteure gelungen. Es ist daher ein Buch, das alle Kunsthochschulanwärter noch vor der Aufnahmeprüfung zu Aufklärungszwecken lesen sollten. Auch allen bereits praktizierenden Künstlern sei die Lektüre wärmstens empfohlen. Sie erfahren dabei zwar nichts, was sie nicht längst wüssten und meistenteils erfolgreich verdrängen. Lundkvist gelingt es jedoch, die Absurditäten des zeitgenössischen Künstlerdaseins noch einmal so prägnant und mit Humor zusammenzufassen, dass sich trotz aller Betroffenheit eine gewisse Heiterkeit einstellt und die Frage nach dem Sinn des Ganzen ein neues Gewicht erhält.
Der Autor bezeichnet seinen Text, der sich in Form eines rasanten Redeschwalls über die Leser ergießt, als Roman. Dieser sei Fiktion und keine Autobiografie, betont er in einem Interview, speise sich aber aus zahlreichen persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen, die man eben so macht, wenn man sich jahrelang im Kunstbetrieb bewegt. Besser gesagt in dessen „unterem Segment“, also dort, wo circa drei Viertel aller Kunstschaffenden unterwegs sind (in Berlin sind es sogar mehr, wie die letzte IFSE-Studie gezeigt hat). So auch der namenlose Ich-Erzähler – einer der unzähligen professionellen, aber von den Gatekeepern des Kunstbetriebs kontinuierlich ignorierten Künstlern und Schriftstellern, die von ihrem Beruf nicht leben können. Diese Kaste wird gerne hoffnungsvoll als „emerging artists“ bezeichnet (vor allem von sich selbst) – schließlich könnte ihre Arbeit jeden Moment entdeckt werden und einen Wertzuwachs verzeichnen. Bis es so weit ist, realisieren diese potenziellen „upcoming artists“ unermüdlich Ausstellungen, Projekte und Kunstobjekte, um bloß nicht dem Aufmerksamkeitsradar zu entgehen. Im Gegensatz zu den „established artists“ erhalten sie für diese Leistungen, die von Institutionen und Ausstellungsorten gerne angenommen werden, allerdings nur in seltenen Fällen Geld. Stattdessen werden sie mit der kunstbetriebseigenen Währung namens „kulturelles Kapital“ entlohnt.
Dieser Begriff geht auf den Soziologen Pierre Bourdieu und seine Kapitalsortentheorie aus den 1970er-Jahren zurück. Im Falle des „emerging artist“ bedeutet er in erster Linie: Mit den richtigen Leuten an den richtigen Orten zu den richtigen Themen auszustellen, und das so oft wie möglich. Folgt man Bourdieus Thesen, führt viel kulturelles Kapital in Form von Bildung, einschlägigen Beziehungen, Renommee und Reputation irgendwann zu Einfluss und Positionen und damit auch zu ökonomischem Kapital, also Geld. Um kulturelles Kapital zu erwerben, muss man aber zunächst eine ganze Menge Geld investieren (oder viel besser: schon haben), damit die Transformation künftig auch in die umgekehrte Richtung verläuft, bestenfalls mit ordentlich Gewinn. Irgendwann, so die auf dieser These beruhende Legende, die man sich in Kunstkreisen immer wieder gerne erzählt, zahlt sich das prekäre Dasein als „emerging artist“ also ganz bestimmt aus. Einfach mal dranbleiben und sich nicht von den monetären Rahmenbedingungen beirren lassen. Wie all die anderen Kollegen in ähnlicher Lage, kann auch Lundkvists emerging artist seine kreative Produktion bis zu diesem spekulativen Moment des großen „Durchbruchs“ allerdings nur aufrechterhalten, weil er permanent seine eigenen finanziellen Rücklagen und das Geld anderer Leute hineinpumpt. Genau wie an der Börse lautet das Stichwort dabei „Risikokapital anziehen“:
„we were essentially building up our
‚artistic practices‘ with debt
Or seen from a slightly different angle,
with foreign investment
Or from yet another perspective,
with venture capital“
Der Romanprotagonist schildert, wie er sozusagen nebenbei allerlei zeitgenössischen Jobs, heute gerne auch „Gigs“ genannt, nachgeht. Zum Beispiel als Autor von Texten, die ausschließlich von Google Bots und Algorithmen gelesen werden (aber immerhin gelesen und sogar analysiert werden, ganz im Gegensatz zu den Texten, die er für Kunstkataloge produziert), oder – Klassiker! – als Tresenkraft in einer Weinbar. Nicht ohne Stolz stellt er dabei fest, dass er sich in eine lange, ehrenhafte Traditionslinie einreiht:
„being part of a tradition of artists and writers
working in bars“
So weit, so gut, er produziert fleißig und stellt immer wieder aus, scheinbar läuft die Sache an. Als sich seine finanzielle Situation jedoch allem Aktionismus zum Trotz auch nach Jahren nicht zum Besseren verändert hat, wächst in ihm ein furchtbarer Verdacht:
„the ‚emerging‘ in ‚emerging artists‘ was more of a perpetual state of being … A permanent condition … A form of existence that never took actual form“
Wenn einem angesichts des gehorteten Bergs an kulturellem Kapital plötzlich klar wird, dass man längst als „mid-career artist“ durchgehen müsste, aber noch immer nicht ansatzweise die laufenden Produktionskosten erwirtschaftet, geschweige denn so etwas wie einen Gewinn, dann befindet man sich auf Augenhöhe mit der Schizophrenie einer Simulationsgesellschaft, in der die Dinge ganz anders liegen als sie nach außen hin scheinen und präsentiert werden:
„The fact that I could call myself both an artist and a writer despite making practically no money from either writing or producing artworks was conceptually possible because of the extreme division between what things were and how they were presented … from the ruling ideology sold as ‚freedom‘, to the hyper-processed, food-like substances sold as ‚food‘, and the latest apps sold as ‚revolutionary‘.“
Lundkvists Roman berichtet von Kunstschaffenden, die auf ihrem kulturellem Kapital sitzen bleiben, weil diese Währung in einem an kreativer Inflation und Verstopfung leidenden Kunstbetrieb hoffnungslos kollabiert ist; die immer wieder bereit sind, sich auf die unmöglichsten Konditionen einzulassen und dann mit entsprechend wenig Respekt behandelt werden; deren CVs immer länger werden und die ihre unzähligen Kunstwerke, produziert für immer neue Ausstellungen mit relevanten Titeln in ambitionierten Off Spaces schlussendlich aus Platz- und Karmagründen im Storage Space einbunkern müssen – Leute, die kaum ihre Miete zahlen können, während sie zugleich „based in Copenhagen, Berlin, and Los Angeles“ sind und im Callcenter oder als Aufsichtsperson in Galerien arbeiten. Er zeichnet aber nicht nur ein scharfes Bild des Kunstbetriebs, sondern auch unserer Zeit an sich, wenn er von Dematerialisierung, Inszenierung, cleveren Tech Start-ups und simulierten „Ersatz“-Versionen einer hinter Spekulationen verschwindenden Realität erzählt:
„the present existed mostly in the form of a speculation
of its future self“
Über alldem hängt die gegenwärtige Ökonomie wie eine dunkle Wolke, sie kriecht hinein bis in die Form des Textes, der genauso atemlos daherkommt wie der Protagonist, der in seinem künstlerischen Hamsterrad emsig vor sich hin rotiert. Bis er dann schließlich doch irgendwann hinschmeißt – planned obsolescence. Mantraartig zählt Lundkvist in seinem Buch die Zusammenhänge auf, mit denen er sich und den „many others“ erklärt, warum es trotz aller Anstrengung (oder gerade deswegen?) nicht geschmeidig läuft. Beim Lesen dieser Litanei taucht unwillkürlich das Bild eines Auktionators vor dem inneren Auge auf, der in schnellem Tempo verkaufstechnische Textkaskaden heruntersingt. Auch Lundkvists Buch kommt ganz ohne Punkte aus, dafür prasseln etliche Fragezeichen und einige durchaus beunruhigende Spoilerwarnungen auf die Lesenden ein.
Apropos Spoiler: Der Protagonist hat am Ende wirre Träume von einer App namens „Second Europe“ und von Avataren, die als „Ersatz“-Künstler (oder umgekehrt) umherirren. Angesichts seiner nicht stattgefundenen Kreativkarriere bleibt ihm wenigstens eine tröstliche Einsicht:
„‚Better a real person than an emerging artist,‘
I thought ‚An emerging artist is not emerging at all,
but a real person is at least a real person,
and that’s better than nothing‘“
Henning Lundkvist, „Planned Obsolescence – A Retrospective“, ATLAS Projectos, ISBN 978-989-97141-8-2, 10 Euro
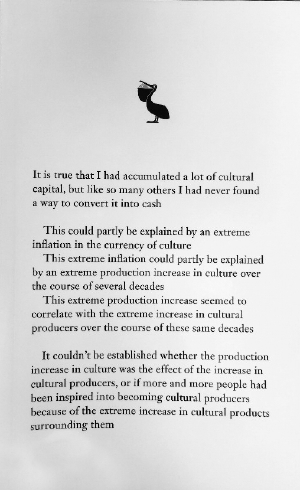
Cover: Henning Lundkvist
„Planned Obsolescence – A Retrospective“
„Planned Obsolescence – A Retrospective“
